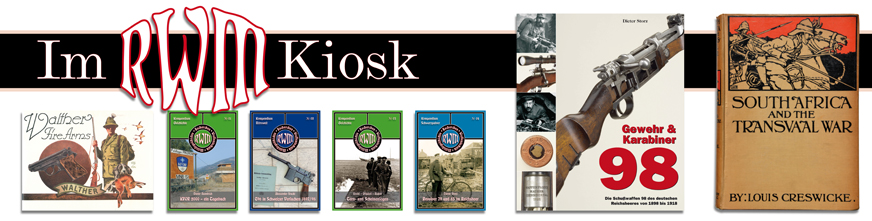Buch: Schuster "Das Ausstattungssoll der Heeresangehörigen der Bundeswehr von 1955 bis 2010"
 |
Das Ausstattungssoll der Heeresangehörigen der Bundeswehr von 1955 bis 2010Schuster, Lothar. 373 Seiten, Berlin 2011. ISBN 978-3-938447-47-5, Preis: 69,95 €
Das vorliegende Buch ist eine umfassende Zusammenstellung dessen, was seit der Neuaufstellung der westdeutschen Streitkraft 1955 bis in die Gegenwart der gesamtdeutschen Armee je an Heeresangehörige ausgegeben wurde. Der Autor beschränkt sich dabei nicht auf die Uniformierung, sondern reiht akribisch alle Ausrüstungsgegenstände auf, die man je auf seiner Bekleidungsstammkarte hat finden können. Gezeigt werden Ausgehanzüge, Kopfbedeckungen, Helme, Stiefel, taschen, Rucksäcke, ABC-Schutzausrüstung usw. bis hin zur Garnrolle. |
MHM Dresden: Neueröffnung am 15. Oktober 2011
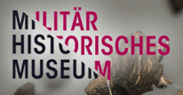 |
Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr (MHM) in Dresden öffnet am 15. Oktober 2011 seine vollkommen neu gestaltete Ausstellung für das Publikum.Das Museum zeigt auf rund 10'000 Quadratmetern Ausstelllungsfläche eine thematische und eine chronologische Ausstellung zur Militärgeschichte. |
In der neuen Ausstellung soll "ein nationales militärisches Museum ... voller Erwartungsbrüche und Perspektivwechsel" einen "Ort des Nachdenkens ... und der Auseinandersetzung mit Fragen von Krieg und Frieden, von Gewalt und Toleranz sowie des Verhältnisses von Krieg und Gesellschaft" schaffen, wie der Direktor des Museums, Oberst PD Dr. Rogg, betont.
Das Eröffnungsprogramm zwischen 15. bis 18. Oktober umfaßt Auftritte des Balletts der Semperoper, Künstlerdiskussionen, Vorführungen der Militärtechnik, Podien, Führungen und Musikdarbietungen.
Völlig neugestaltet präsentiert sich auch der Netzauftritt des Museums.
Viktor von Bülow: Personalakte des Oberleutnants
 |
Das Bundesarchiv verwahrt die Personalakte des verstorbenen Komikers Viktor von Bülow.Der Kriegsfreiwillige trat 1941 in die Wehrmacht ein und erlebte das Kriegsende als Oberleutnant. Eine ausführliche Beschreibung der Akte, die das Heeres-Personalamt bis Mitte 1944 führte, finden Sie hier. |
Antikentempel Potsdam: Spendenaufruf zur Restaurierung
 |
Der Antikentempel im Garten des Schlosses von Sanssouci in Potsdam ist Grablege des Hauses Hohenzollern. Gebäude und Sarkopharge sind beschädigt. Ein Spendenaufruf soll die Restaurierung ermöglichen.Der Tempel entstand im Auftrage Friedrich II. und beherbergte zunächst eine Sammlung antiker Statuen und Gemmen. Später wurde er zu einer Begräbnisstätte umfunktioniert und ist es noch heute. Hier liegen die sterblichen Überreste der Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten Auguste Viktoria, Deutsche Kaiserin (1. Gemahlin Kaiser Wilhelm II.), Eitel Friedrich, Prinz von Preußen (Sohn des Kaiserpaares, letzter Kommandeur des Ersten Garderegiments zu |
Fuß),Joachim, Prinz von Preußen (Sohn des Kaiserpaares), Wilhelm, Prinz von Preußen (Sohn des Kronprinzen Wilhelm, gefallen im Westfeldzug 1940, Bruder von Louis Ferdinand, dem langjährigen Chef des Hauses Hohenzollern und Großvater des jetzigen Chefs Georg Friedrich) und schließlich Hermine von Reuß ältere Linie, Prinzessin von Preußen (2. Gemahlin Wilhelm II.).
Das Gebäude befindet sich in schlechtem Zustand. Durch Beschädigungen der Fassade und der Fenster ist es überdies zu starken Schäden, u. a. durch Wurmbefall an den dort stehenden Holz-Särgen gekommen. Dies betrifft alle dort befindlichen Särge außer dem der Kaiserin, deren Sarg in einem Marmor-Sarkophag steht und daher gut geschützt ist.
Ein Privatmann möchte die Restaurierung der Särge mit Spenden unterstützen. Er ruft zu Spendenzahlungen auf ein Konto der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) auf.
Informationen zu diesem Projekt finden Sie in einem ![]() Antikenschlößchen Potsdam (1.09 MB). Weitere Fragen beantwortet der Privatmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Antikenschlößchen Potsdam (1.09 MB). Weitere Fragen beantwortet der Privatmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Schwarzer Tag der Schwarzen Wacht - Magersfontein
 |
Untypisch für den Zweiten Burenkrieg mag die Schlacht von Magersfontein gewesen sein. Neben eklatangten Führungsfehlern zeigt sie aber schon Merkmale dessen, was 15 Jahre später das alte Europa zerstören sollte: des Material- und Grabenkrieges. Von Dr. Elmar Heinz Bilder: Mag. Reinolf Reisinger
Die Briten folgten einem „Hilferuf“ der „uitlanders“ in den Republiken vom Mai 1899 gerne. Mitte November hatten sie genügend Truppen am Kap, um angreifen zu können. Eines der ersten Ziele war Kimberley an der Grenze des Freistaats zum Griqualand (s. S. 220 F4). Die Stadt, in der sich Cecil Rhodes aufhielt, war abgeschnitten. Ein Entsatzversuch führte im Dezember zur Schlacht von Magersfontein, wo konventionell ausgebildete Briten mit locker formierten Buren rangen. |
Weiterlesen: Schwarzer Tag der Schwarzen Wacht - Magersfontein
Verzweifelter Endkampf der Guerilla
 |
In der zweiten Phase der Burenkriege standen sich keine regulären Einheiten mehr gegenüber. Die Buren führten einen Guerillakrieg. Die Briten entzogen ihnen mit der Strategie der verbrannten Erde die Lebensgrundlage. Zehntausende Zivilisten starben in britischen Konzentrationslagern. Von Dr. Klaus-Jürgen Bremm
Im Sommer 1900 kehrte der Arzt, Abenteurer und Schriftsteller Arthur Conan Doyle aus Südafrika nach London zurück. Der Vierzigjährige hatte als Kriegsfreiwilliger in britischen Militärlazaretten gedient und veröffentlichte noch im Oktober ein vielbeachtetes Buch über den zweiten Burenkrieg, dem 1902 ein weiteres Buch folgte. Für dieses patriotische Werk wurde er geadelt. Erst wenige Wochen zuvor, am 5. Juni 1900 hatten die Truppen des britischen Oberbefehlshabers in Südafrika, Lord Frederik Roberts (1832-1914) Pretoria, die Hauptstadt des Freistaates Transvaal besetzt. Bloemfontein, die Kapitale der südlicheren Burenrepublik Oranje-Freistaat, war schon am 13. März gefallen. |
Burenkrieg beschleunigt die Neuuniformierung
 |
Bereits vor 1899 stellten die Briten ihre Uniformierung teilweise auf Khaki um. Der Kampf in Südafrika bewirkte, daß diese Farben das traditionelle Rot im Feld verdrängte. Von Alfred Umhey
Obwohl man Khakiuniformen in der britischen Armee bereits ab der Mitte des 19. Jahrhunderts trug, wurden erstmals im Burenkrieg alle im Einsatz befindlichen Einheiten einschließlich der Landungsabteilungen der Royal Navy in dieser Farbe eingekleidet. Karkee ist das Urdu-Wort für Staub. Die verschiedenen Töne reichten von mausgrau bis gelbgrün, je nach Stoff, Hersteller und Alter. Interessanterweise mußte der leichte Khakidrell der aus Indien eintreffenden Truppen durch ein dickeres Wollgewebe ersetzt werden. Da sich diese Felduniform bewährte, wurde mit Armeebefehl Nr.10 vom 1. Februar 1902 das Khakituch allgemein für die Dienstuniform bestimmt. Der für die britische Armee emblematische rote Rock verblieb allerdings als Paradeuniform. In nur zwei Jahren änderte sich die Uniform der Briten grundlegend. Wie in fast allen Feldzügen des 19.Jahrhunderts zogen die Soldaten sehr schnell die Konsequenzen aus der hier besonderen Situation und aptierten die Uniform unter praktischen Gesichtspunkten. |
Die britische Armee war über die ganze Welt verstreut
 |
Das britische Heer war über alle Besitzungen verstreut, um dort den Herrschaftsanspruch aufrecht zu erhalten. Zum Kampf gegen die Buren mußten die Briten deshalb die Reserve der Heimatarmee anzapfen. Von Dr. Elmar Heinz
Der Herzog von Cambridge, lange Jahre Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte, rang den Niederlagen bei Kriegsbeginn etwas Tröstliches ab: „Der Krieg in Südafrika geht vorläufig nicht besonders, über seine politische Seite und Entstehung läßt sich viel sagen. Aber er gibt dem englischen Adel Gelegenheit, zu zeigen, daß er noch zu sterben weiß, und das freut mich“. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte die britische Armee bis auf sieben Jahre ununterbrochen viele kleine Einzelkonflikte in allen Ecken der Welt durchgefochten. Deren Erfahrungen waren für die jeweils folgenden kaum brauchbar und auch nicht systematisch ausgewertet worden. |
Weiterlesen: Die britische Armee war über die ganze Welt verstreut
Buch: Schmidt "Das Mainzer Bernsteinzimmer"
 |
Das Mainzer BernsteinzimmerSchmidt, Dieter. 190 Seiten, Mainz 2011. ISBN 978-3-980939546, Preis: 11,95 €
|
Die Burenrepubliken und ihre Streitkräfte
 |
Das gesamte 19. Jahrhundert zogen sich die Auseinandersetzungen zwischen Buren und Briten wie ein blutroter Faden durch die Geschichte des südlichen Afrikas. Sie endeten 1902 mit der vernichtenden Niederlage der Buren. Wie konnten sie so lange erfolgreich dem übermächtigen Empire trotzen?
Von Gerhard Ortmeier M.A. und Dr. Elmar Heinz
Die Geschichte der Buren begann 1652, als die umtriebige niederländische Ostindien-Kompanie für ihre Segelschiffe mit Kapstadt eine Zwischenstation auf dem Weg zu den fernöstlichen Kolonien errichtete. Es folgte eine Welle niederländischer, deutscher und französischer, meist hugenottischer Auswanderer, die unter holländischer Schirmherrschaft weite Teile Südafrikas besiedelten. Die widrigen Umstände, zu denen neben den Herausforderungen der Natur auch heftige Auseinandersetzungen mit schwarzafrikanischen Stämmen zählten, formten aus den Einwanderern rasch einen harten, anspruchslosen und unabhängigen Menschenschlag. Die Siedler lebten von der Landwirtschaft, oftmals als halbnomadische Viehzüchter. Deshalb bürgerte sich ab dem Ende des 18. Jahrhunderts für sie der Begriff „Boers“ oder „Buren“ ein. Sie selbst bezeichneten sich allerdings als „Afrikaaner“. |